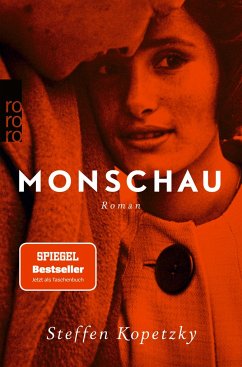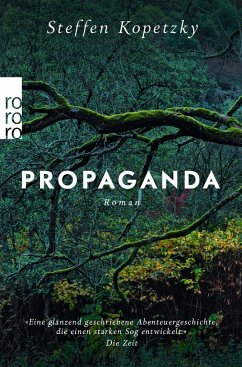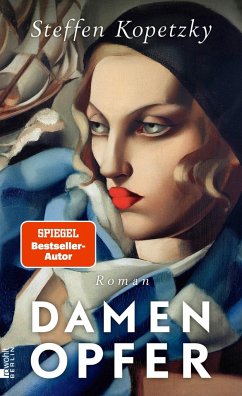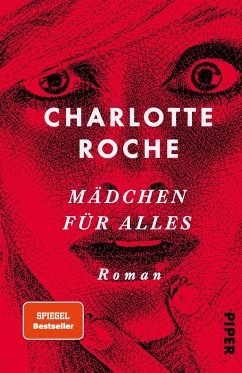Nicht lieferbar
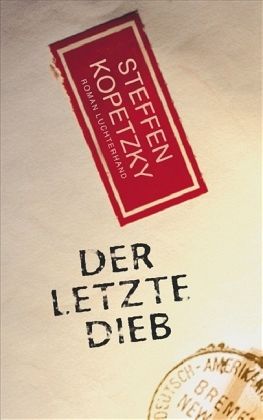
Der letzte Dieb
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Eine hochspannende Schatzsuche, eine atemberaubende Verschwörungsgeschichte
Alexander Salem ist als routinierter Auftrags-Dieb gut im Geschäft. Doch als er aus einem Hotel in Monaco einen kostbaren Briefumschlag entwenden soll, begeht er einen folgenschweren Fehler. Seine letzte Chance ist, an einer ominösen Schatzsuche teilzunehmen, die ihn weit in die eigene Vergangenheit und in die Abgründe des 20. Jahrhunderts führen wird.
Diebstahl ist eine Kunst voll diskreter Eleganz. Aber wer beherrscht sie heutzutage noch? Nach dem Erfolgsroman 'Grand Tour' hat Steffen Kopetzky ein Großpanorama des Stehlens entworfen: Ihres Lebenssinns verlustig gegangene Ex-Geheimdienstagenten, über Schreibblockaden irre gewordene Heftchenromanautoren und eine Handvoll verzweifelt anständig Gebliebener liefern sich einen erbitterten Wettlauf um ein Geheimnis, von dem niemand weiß, ob es nicht lediglich erfunden ist. Ein abenteuerlicher Roman über die verborgenen Dinge in einem selbst und in der Welt, eine Kulturgeschichte der Schließtechnik und eine hochspannende Schatzsuche, ein Epos von Schuld, Gier und der ewigen Verlockung des Verschlossenen.
"Ein großer Wurf." Focus über "Grand Tour" "Ein witziges, weises, gewagtes, abenteuerliches - kurz: ganz und gar hinreißendes Buch." stern über "Grand Tour"
Alexander Salem ist als routinierter Auftrags-Dieb gut im Geschäft. Doch als er aus einem Hotel in Monaco einen kostbaren Briefumschlag entwenden soll, begeht er einen folgenschweren Fehler. Seine letzte Chance ist, an einer ominösen Schatzsuche teilzunehmen, die ihn weit in die eigene Vergangenheit und in die Abgründe des 20. Jahrhunderts führen wird.
Diebstahl ist eine Kunst voll diskreter Eleganz. Aber wer beherrscht sie heutzutage noch? Nach dem Erfolgsroman 'Grand Tour' hat Steffen Kopetzky ein Großpanorama des Stehlens entworfen: Ihres Lebenssinns verlustig gegangene Ex-Geheimdienstagenten, über Schreibblockaden irre gewordene Heftchenromanautoren und eine Handvoll verzweifelt anständig Gebliebener liefern sich einen erbitterten Wettlauf um ein Geheimnis, von dem niemand weiß, ob es nicht lediglich erfunden ist. Ein abenteuerlicher Roman über die verborgenen Dinge in einem selbst und in der Welt, eine Kulturgeschichte der Schließtechnik und eine hochspannende Schatzsuche, ein Epos von Schuld, Gier und der ewigen Verlockung des Verschlossenen.
"Ein großer Wurf." Focus über "Grand Tour" "Ein witziges, weises, gewagtes, abenteuerliches - kurz: ganz und gar hinreißendes Buch." stern über "Grand Tour"